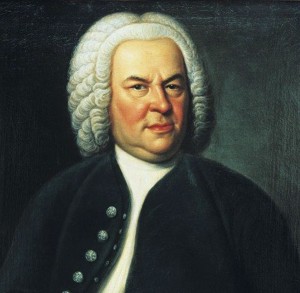Göttinger Kantate von Günter Weisenborn
„Die Pläne einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr erfüllen die unterzeichnenden Atomforscher mit tiefer Sorge.“
So lautet der Beginn einer Erklärung von 18 Naturwissenschaftlern aus der Bundesrepublik Deutschland, die am 12. April 1957 veröffentlicht wurde. Wir stellten die Lesung des vollständigen Dokuments an den Anfang unserer Veranstaltung „Göttinger Kantate. Reflexion über einen radikal-pazifistischen Text“. Das Manifest wurde vorgetragen von den Jugendlichen Japer Eder, Niklas Rettig und Carl Schipper.
1956 hatte Verteidigungsminister Franz Josef Strauß mit Billigung des Kanzlers Konrad Adenauer einen sogenannten „Drei-Stufen Plan“ zum ersten deutschen Atomprogramm im zivilen Bereich vorgelegt.
Die Diskussion um eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr führte zu einer großen Anzahl von Protesten und schließlich zu der „Göttinger Erklärung“, die unter anderen von Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Fritz Straßmann und Carl Friedrich Frhr. v. Weizsäcker unterszeichnet wurde.
Ein Jahr nach diesem Manifest wurde die sogenannte „Göttinger Kantate“ in Stuttgart uraufgeführt. Der Verfasser war Günter Weisenborn, Schriftsteller und Widerstandskämpfer; er lebte von 1902 bis 1969. Weisenborn war u.a. Dramaturg an der Berliner Volksbühne, wo 1928 sein Antikriegsstück „U-Boot S4“ uraufgeführt wurde. Nach kurzer Emigration in den USA kehrte Weisenborn nach Berlin zurück und führte ein Doppelleben: Einerseits als Dramaturg und Autor am Schillertheater, andererseits als Unterstützer der Widerstandsorganisation um Harro Schulze-Boysen.
Er wurde 1943 wegen Hochverrats zum Tode verurteilt; das Urteil wurde später in eine Zuchthausstrafe umgewandelt. Als Pazifist stellte er sich gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland; deutlich wird dies ganz offensichtlich in der „Göttinger Kantate“, die unter der Regie von Erwin Piscator 1958 in der Stuttgarter Liederhalle uraufgeführt wurde. In der Tradition des Brecht‘schen Theaters verfasste er diesen Text als Appell in einer Mischung aus dokumentarischen, dialogischen und lyrischen Passagen mit den Stimmen des Volkes in rhythmisch geprägter Sprache.
Da die ursprünglich komponierte Musik verschollen ist, haben wir den Komponisten Aaron Dan gebeten, Musik für den Text zu komponieren. Der Titel des Stückes heißt ja schließlich „Göttinger Kantate“. Im ersten Teil wird von einem „Berichter“ (Jürgen Schirm) über die Vorbereitung des Abwurfs der ersten Atombombe erzählt:
Es begab sich aber,
dass ein Volk in der Mitte eines Kontinents
den Beschwörungen seiner Politiker glaubte,
ihren falschen Beruhigungen
und ihren echten Drohungen.
Und das Volk folgte diesen Politikern
in die Vernichtung, andere vernichtend.
Es hauste aber damals
ein Gespenst in der Welt: Angst
Es folgen Auseinandersetzungen zwischen den Wissenschaftlern, Politikern (Catharina Oerke) und Industriellen über Ziele und Implikationen atomarer Bewaffnung; dazu kommen die Warnungen aus der Bevölkerung. Letztere werden von einem Sprechchor aus Jugendlichen der Gemeinde (Greta Böckenholt, Fiona Römermann, Charlotte und Pauline Südmeyer, Antonia Schirm) und einer Sprecherin in einer Mischung aus Gesang und rhythmischem Sprechen vorgetragen (Annette Tangermann):
Eine Wolke zieht vorüber
wie ein großes Hirn so grau.
Bei einer Atomversuchsexplosion
zog sie oben leise davon,
und der Himmel war
wie einst in Japan so blau.
In der verlorenen Wolke jedoch,
da saß ein großer Tod,
der hat über die Welt
Strontium 90 gesät,
da war es für viele Kinder zu spät,
da war jeder von uns bedroht.
Die wissenschaftlichen und sachlichen Grundlagen, die angesichts atomarer Bedrohung in ihren politischen und gesellschaftlichen Folgen sehr kompliziert und komplex sind, werden in der Kantate oft auf einfache Gegenüberstellungen reduziert. Wir wollten diesem Phänomen mit der „Reflexion ÜBER die Kantate“ begegnen und den radikal-pazifistische Ansatz diskutieren.
Das war auch der Grund, weshalb wir nur kleine exemplarische Ausschnitte der Kantate vorgestellt haben. Der emotionale und appellative Charakter bleibt komplex genug.
Damit blieb Platz für die anschließende Diskussion mit dem Physiker Prof. Dr. Martin Wil-
kens und dem Referenten im BMVg Sascha Albrecht, die aus ihrer Sicht über die aktuelle Situation angesicht der atomaren Bedrohung referierten. Die Diskussion unter der Leitung von Pfarrerin Sapna Joshi zeigte, wie wichtig eine reflektierte Auseinandersetzung über das alle Menschen betreffende Problem auch im kirchlichen Raum ist. Der Komponist Aaron Dan hatte das Schlussstück der Göttinger Kantate mit einer Paraphrase zu „Verleih uns Frieden gnädiglich“ am Klavier eingeleitet.